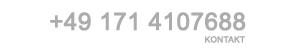Kontrolliertes Trinken in der MPU scheint für viele Betroffene zunächst die perfekte Lösung: kein langes Abstinenzprogramm, kein teurer Alkoholnachweis, und trotzdem bleibt der Konsum erlaubt – wenn auch in stark reduzierter Form. Doch die Realität ist komplexer. Wer seine Fahrerlaubnis zurückbekommen möchte, muss klare Regeln einhalten und nachweisen, dass er Alkohol verantwortungsbewusst konsumiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Ist die MPU mit kontrolliertem Trinken bestehbar?
- 3 Was bedeutet kontrolliertes Trinken bei der MPU?
- 4 Wie lernt man kontrolliertes Trinken?
- 5 Wieviel Alkohol ist beim kontrollierten Trinken erlaubt?
- 6 Wer besteht die MPU mit kontrolliertem Trinken?
- 7 Veränderungen 2023: Neue Begutachtungsrichtlinien
- 8 MPU ohne Abstinenznachweis – Chancen und Risiken
- 9 Fazit
Das Wichtigste in Kürze
- Kontrolliertes Trinken bedeutet lebenslange Einschränkung, kein gelegentlicher Verzicht.
- Ein Trinktagebuch beweist kontrolliertes Trinken am besten.
- Seit 2023 fordern neue Richtlinien eine Trinkpause vor Beginn des kontrollierten Konsums.
- Die Grenze liegt bei maximal 0,5 Promille – niemals Schwipps oder Rausch.
- Eine MPU ohne Abstinenznachweis ist möglich, bleibt aber deutlich schwerer.
Ist die MPU mit kontrolliertem Trinken bestehbar?
Ja, Betroffene bestehen die MPU mit kontrolliertem Trinken, wenn kein Alkoholmissbrauch oder eine Abhängigkeit vorliegt. Allerdings verlangen die Richtlinien ab Mitte 2023 meistens eine vorherige Abstinenzphase, was die Chancen stark reduziert.
Was bedeutet kontrolliertes Trinken bei der MPU?
Kontrolliertes Trinken beschreibt keine kurzfristige Einschränkung, sondern eine dauerhafte Lebensentscheidung. Betroffene verpflichten sich, Alkohol nur in sehr kleinen Mengen und ausschließlich aus Genussgründen zu trinken. Der Konsum darf weder regelmäßig noch exzessiv erfolgen. Rauschzustände schließt das Konzept aus. Wichtig ist auch: Nutzen Betroffene Alkohol nicht zur Stressbewältigung oder zur Problemlösung.
Der Gutachter prüft in der MPU genau, ob die Kandidaten ihre Konsumgrenzen kennen und einhalten. Viele unterschätzen die Schwierigkeit: Wer Promillewerte nicht exakt berechnet, verliert schnell die Kontrolle. Nur wer dauerhaft beweist, dass er Alkohol nicht mehr „funktionalisiert“, hat realistische Chancen auf ein positives MPU-Gutachten.
Wie lernt man kontrolliertes Trinken?
Das Erlernen eines verantwortungsvollen Konsums erfordert Struktur und Selbstdisziplin. Eine bewährte Methode ist das Führen eines Trinktagebuchs. Dokumentieren Sie hier Zeitpunkt, Anlass und Menge des Konsums. Ein PDF- oder Excel-Plan hilft, Muster im eigenen Verhalten zu erkennen. So wird sichtbar, ob man die akzeptierten Grenzen einhält.
Die MPU-Gutachter schätzen es, wenn Kandidaten ein solches Dokument vorlegen. Es ersetzt keinen Beweis, signalisiert aber, dass man sich ernsthaft mit seinem Verhalten auseinandersetzt. Eine Haaranalyse eignet sich dagegen nicht, weil sie bei jedem Konsum positiv ausfällt. Wer kontrolliert trinken will, muss sich auch mit den eigenen Risikosituationen auseinandersetzen. Dazu gehört, Alternativen zu Alkohol zu finden und Strategien zu entwickeln, in denen Verzicht leichter fällt.
Wieviel Alkohol ist beim kontrollierten Trinken erlaubt?
Eine der häufigsten Fragen lautet: Welche Menge ist noch zulässig? Die Antwort hängt von Körpergewicht und Geschlecht ab, doch eine klare Grenze gilt: niemals über 0,5 Promille. Selbst ein leichter Schwipps wird zum Problem. Für die MPU entscheidet, dass der Konsum nie zum Kontrollverlust führt.
Praktisch bedeutet das: maximal ein Glas Bier oder Wein bei einem Anlass, niemals mehrere Getränke hintereinander. Auch Mischkonsum – Alkohol in Kombination mit anderen Substanzen – ist ausgeschlossen. Wer sicher gehen will, berechnet regelmäßig seine Promillewerte. Zusätzlich sollten Betroffene sich angewöhnen, nicht mehr aus Langeweile oder Stress zu trinken. Ziel ist, dass Alkohol seinen Stellenwert einbüßt.
Wer besteht die MPU mit kontrolliertem Trinken?
Nicht jeder eignet sich für diesen Weg. Laut Begutachtungsleitlinien 2023 gilt: Nur wer keinen Missbrauch und keine Abhängigkeit zeigte, kommt für kontrolliertes Trinken infrage. Wer mehr als ein Alkoholdelikt hatte, über 1,6 Promille auffiel oder zusätzlich ein Drogendelikt beging, arbeitet mit Abstinenz.
Chancen bestehen vor allem für Kandidaten mit einem einmaligen Vorfall und niedriger Promillezahl. Dennoch verlangt der Gutachter überzeugende Argumente. Betroffene müssen zeigen, dass sie ihre Trinkgewohnheiten dauerhaft veränderten. Das bedeutet: kein versteckter hoher Konsum, keine Bagatellisierung, sondern nachvollziehbare Selbstkontrolle. Nur so gelingt es, das Vertrauen der MPU-Psychologen zu gewinnen.

Veränderungen 2023: Neue Begutachtungsrichtlinien
Ab Mitte 2023 verschärften die Richtlinien die Anforderungen deutlich. Auch wer kontrolliert trinkt, muss vorab eine Trinkpause einlegen. Diese Abstinenzphase soll beweisen, dass Betroffene den Konsum bewusst unterbrechen können. Erst danach akzeptieren Gutachter ein kontrolliertes Weitertrinken.
Diese Regelung schafft Unsicherheiten, weil sie den Spagat zwischen Abstinenz und Konsum verlangt. Für MPU-Kandidaten bedeutet das: Wer ohne Abstinenznachweis bestehen will, sollte sich beeilen oder ein alternatives Programm wählen. Der Handlungsspielraum ist kleiner geworden. Wichtig bleibt, dass Gutachter eine klare innere Haltung erkennen. Wer schwankt oder halbherzig wirkt, hat kaum Chancen.
MPU ohne Abstinenznachweis – Chancen und Risiken
Eine MPU ohne Abstinenznachweis ist zwar möglich, bleibt aber der schwierigere Weg. Gutachter stellen gezielt Fragen, die die Konsequenz und Selbstkontrolle prüfen. Typische Fragen lauten: Wie sichern Sie ab, dass Sie nie wieder alkoholisiert fahren? Warum entschieden Sie sich gegen Abstinenz?
Wie verhindern Sie Rückfälle? Nur wer hier schlüssige Antworten gibt, überzeugt. Zudem muss die Psychologin spüren, dass die Entscheidung unumstößlich ist. Zweifel führen fast immer zu einem negativen Gutachten. Ein Risiko stellt auch die Rückfallquote dar. Viele Betroffene unterschätzen, wie schnell alte Muster zurückkehren. Deshalb raten Fachleute oft doch zur Abstinenz, auch wenn der Aufwand größer ist.
Fazit
Kontrolliertes Trinken in der MPU wirkt auf den ersten Blick wie ein bequemer Ausweg, ist aber mit erheblichen Hürden verbunden. Nur wer seine Konsumgrenzen strikt einhält, überzeugend dokumentiert und den Gutachter vollständig von seiner Selbstkontrolle überzeugt, hat eine Chance. Mit den Änderungen ab 2023 wird der Spielraum kleiner. Für viele bleibt Abstinenz die sicherere Wahl. Wer dennoch kontrolliertes Trinken anstrebt, sollte frühzeitig üben, dokumentieren und eine klare Haltung entwickeln.
Quellen: