Ein Alkoholentzug ist ein schwieriger, aber wichtiger Schritt in Richtung Gesundheit. Wer regelmäßig große Mengen Alkohol trinkt und aufhören möchte, fürchtet häufig die Entzugserscheinungen. Zittern, Schweißausbrüche, Übelkeit und Schlafstörungen gehören zu den typischen Symptomen. Sie können bereits wenige Stunden nach dem letzten Glas beginnen und in schweren Fällen lebensbedrohlich werden. Eine medizinisch begleitete Entgiftung ist daher entscheidend, um Risiken zu vermeiden und den Körper sicher zu stabilisieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Welche Symptome treten beim Alkoholentzug auf?
- 2.1 Was passiert im Körper beim Alkoholentzug?
- 2.2 Einflussfaktoren auf die Stärke der Entzugserscheinungen
- 2.3 Körperliche Symptome des Alkoholentzugs
- 2.4 Psychische Symptome beim Alkoholentzug
- 2.5 Das Delirium tremens – die gefährlichste Form des Entzugs
- 2.6 Beginn, Dauer und Verlauf der Entzugserscheinungen
- 2.7 Lebensbedrohliche Risiken und die Notwendigkeit des „warmen Entzugs“
- 2.8 Medikamentöse Unterstützung während des Entzugs
- 2.9 MPU-Relevanz und Abstinenznachweise
- 2.10 Postakute Entzugssymptome (PAES) und Craving-Management
- 2.11 Kostenübernahme und Wartezeiten
- 2.12 Fazit
- 2.13 FAQ:
Das Wichtigste in Kürze
- Alkoholentzug löst körperliche und psychische Symptome aus.
- Stärke der Beschwerden hängt von Konsumdauer, Menge und Mischkonsum ab.
- Körperliche Symptome: Magen-Darm-Probleme, Schwitzen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Krampfanfälle.
- Psychische Symptome: Unruhe, Angst, Depression, Halluzinationen, Schlafstörungen.
- Erste Beschwerden treten nach etwa 6 Stunden auf, Höhepunkt nach 24–48 Stunden.
Welche Symptome treten beim Alkoholentzug auf?
Beim Alkoholentzug kommt es durch den Wegfall der gewohnten Alkoholzufuhr zu einer Übererregung des Nervensystems. Dies führt zu körperlichen Beschwerden wie Zittern, Schwitzen und Übelkeit sowie zu psychischen Symptomen wie Angst, Unruhe und Schlafstörungen. In schweren Fällen kann sich ein lebensbedrohliches Delirium tremens entwickeln.
Was passiert im Körper beim Alkoholentzug?
Alkohol wirkt im Gehirn auf Botenstoffe, die für Entspannung und Hemmung sorgen. Bei regelmäßigem Konsum passt sich das Gehirn an diese Wirkung an. Wird die Substanz plötzlich entzogen, fehlt der dämpfende Effekt. Dadurch entsteht eine Überaktivität des Nervensystems. Betroffene fühlen sich unruhig, zittern und schwitzen stark. Auch das Herz-Kreislauf-System reagiert empfindlich, weil die Steuerung durch die Neurotransmitter gestört ist.
Der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz beschleunigt sich und Schwindel kann auftreten. Parallel dazu leidet das Verdauungssystem unter der Umstellung. Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen sind häufig. Zudem kann die Körpertemperatur schwanken. Besonders gefährlich wird es, wenn Krampfanfälle oder Kreislaufzusammenbrüche auftreten. Deshalb sollte ein Entzug niemals ohne ärztliche Begleitung erfolgen.
Einflussfaktoren auf die Stärke der Entzugserscheinungen
Nicht jeder erlebt den Entzug gleich stark. Entscheidend sind Konsumdauer, tägliche Alkoholmenge und allgemeiner Gesundheitszustand. Auch das Alter, die Ernährung und Begleiterkrankungen wie Leber- oder Herzprobleme spielen eine Rolle. Wer über Jahre hinweg regelmäßig trinkt, hat ein höheres Risiko für schwere Symptome.

Mischkonsum mit Drogen oder Medikamenten kann die Beschwerden zusätzlich verstärken. Ebenso beeinflussen psychische Vorerkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen den Verlauf. Körper und Geist müssen sich gleichzeitig umstellen, was das Risiko für Komplikationen erhöht. Deshalb ist es wichtig, den Entzug individuell zu planen und gegebenenfalls stationär durchzuführen. Nur so kann rechtzeitig auf gefährliche Entwicklungen reagiert werden.
Körperliche Symptome des Alkoholentzugs
Die körperlichen Entzugserscheinungen reichen von mild bis lebensbedrohlich. In den ersten Stunden nach dem letzten Glas treten meist Zittern, Schweißausbrüche und Kopfschmerzen auf. Häufig kommen Übelkeit, Durchfall und Appetitlosigkeit hinzu. Viele Betroffene berichten von Herzrasen, Muskelzuckungen und grippeähnlichen Symptomen. In schweren Fällen kann es zu epileptischen Krampfanfällen kommen.
Diese Anfälle sind besonders gefährlich und erfordern sofortige medizinische Behandlung. Der Körper kämpft in dieser Phase um die Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts. Ohne ärztliche Unterstützung drohen Dehydrierung, Kreislaufversagen oder Bewusstlosigkeit. Deshalb sollten Menschen mit starkem Alkoholkonsum niemals allein entziehen. In einer Klinik können Vitalfunktionen überwacht und Komplikationen rechtzeitig erkannt werden.
Typische körperliche Symptome:
| Symptom | Beschreibung |
|---|---|
| Übelkeit und Erbrechen | Reaktion des Verdauungssystems auf Entgiftung |
| Herzrasen, Blutdruckschwankungen | Folge der Nervensystem-Überaktivität |
| Starkes Schwitzen | Versuch des Körpers, Toxine auszuscheiden |
| Zittern | Zeichen der neurologischen Übererregung |
| Krampfanfälle | Akute Gefahr bei unbehandeltem Entzug |
Psychische Symptome beim Alkoholentzug
Psychische Beschwerden sind oft die größte Belastung während des Entzugs. Viele Betroffene leiden unter starker innerer Unruhe und Schlafstörungen. Das Verlangen nach Alkohol, auch „Craving“ genannt, ist besonders quälend. Angstgefühle, depressive Verstimmungen und Reizbarkeit sind häufig. Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, und manche erleben Halluzinationen oder Wahnvorstellungen.
Diese psychischen Reaktionen entstehen, weil das Gehirn die fehlende Alkoholwirkung ausgleichen muss. Es schüttet vermehrt Stresshormone aus, was zu emotionaler Instabilität führt. Die Folge: Stimmungsschwankungen, Nervosität und starke Anspannung. In extremen Fällen können depressive Episoden oder Panikattacken auftreten. Psychologische Betreuung und gegebenenfalls Medikamente helfen, diesen Zustand zu stabilisieren und Rückfälle zu vermeiden.
Das Delirium tremens – die gefährlichste Form des Entzugs
Das Delirium tremens ist die schwerste Komplikation des Alkoholentzugs. Es tritt meist 48 bis 72 Stunden nach dem letzten Alkoholkonsum auf. Typisch sind Halluzinationen, starke Verwirrtheit, Zittern, Fieber und Herzrasen. Betroffene verlieren die Orientierung und erleben intensive Angstzustände. Ohne medizinische Behandlung kann das Delirium tödlich enden – die Sterblichkeitsrate liegt unbehandelt bei bis zu 20 Prozent.
Im Krankenhaus kann sie durch rechtzeitige Intervention auf etwa 2 Prozent gesenkt werden. Das Delirium entsteht durch eine massive Überaktivität des zentralen Nervensystems. Es erfordert eine engmaschige Überwachung, da sowohl Kreislauf als auch Atmung stark belastet sind. Medikamente wie Benzodiazepine helfen, das Nervensystem zu beruhigen und lebensbedrohliche Krampfanfälle zu verhindern.
Beginn, Dauer und Verlauf der Entzugserscheinungen
Die ersten Symptome setzen häufig schon 6 Stunden nach dem letzten Alkoholkonsum ein. Nach 24 bis 48 Stunden erreichen sie ihren Höhepunkt. Besonders in dieser Phase sind Zittern, Schwitzen und Schlaflosigkeit am stärksten. Nach etwa 3 bis 5 Tagen klingen die körperlichen Beschwerden meist ab, während psychische Symptome länger anhalten können.
Ängste, depressive Verstimmungen und Suchtdruck bleiben manchmal über Wochen bestehen. Eine medizinisch betreute Entgiftung kann den Verlauf deutlich erleichtern. Medikamente stabilisieren den Kreislauf, lindern Krämpfe und reduzieren die psychische Belastung. In einer Klinik wird zudem der Flüssigkeitshaushalt überwacht, da Dehydrierung ein häufiges Risiko ist. Der Entzug ist somit planbar und kontrollierbar, wenn er professionell begleitet wird.
Lebensbedrohliche Risiken und die Notwendigkeit des „warmen Entzugs“
Ein eigenständig durchgeführter „kalter Entzug“ ohne ärztliche Unterstützung birgt erhebliche und lebensbedrohliche Risiken, die unbedingt vermieden werden müssen. Zu den akutesten Komplikationen zählen schwere epileptische Anfälle und das gefürchtete Delirium tremens, welches mit Halluzinationen, Verwirrtheit und hohem Fieber einhergeht und tödlich enden kann.
Aus diesem Grund sollte jeder Alkoholentzug als „warmer Entzug“ in einer qualifizierten Fachklinik erfolgen, da hier eine engmaschige medizinische Überwachung und die gezielte medikamentöse Behandlung der Entzugserscheinungen gewährleistet sind.
Medikamentöse Unterstützung während des Entzugs
Während des stationären Alkoholentzugs werden spezifische Medikamente eingesetzt, um die Gefahr schwerwiegender Komplikationen zu minimieren und die Symptome zu lindern. Dazu gehören in erster Linie Benzodiazepine oder Clomethiazol, welche die Übererregung des zentralen Nervensystems dämpfen und damit das Risiko von Krampfanfällen und einem Delirium tremens reduzieren.
Zusätzlich werden oft Vitaminpräparate (insbesondere Vitamin B1/Thiamin) verabreicht, um neurologischen Schäden vorzubeugen, die durch Mangelernährung und den Alkoholkonsum entstehen können. Die medikamentöse Begleitung ist ein entscheidender Teil des sicheren warmen Entzugs.
MPU-Relevanz und Abstinenznachweise
Nach dem Alkoholentzug: Der Nachweis der Abstinenz für die MPU Der erfolgreiche körperliche Alkoholentzug ist nur der erste Schritt; für die Wiedererlangung des Führerscheins folgt der wichtigste: der forensische Abstinenznachweis. Die Fahrerlaubnisbehörde verlangt in der Regel einen Zeitraum von 6 oder 12 Monaten nachgewiesener Abstinenz mittels Urin-Screening oder Haaranalyse (EtG-Wert).
Ohne diesen lückenlosen Nachweis kann die MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) nicht bestanden werden, selbst wenn Sie seit Monaten keinen Alkohol mehr getrunken haben. Sichern Sie Ihren Alkoholentzug daher unmittelbar nach Abschluss der Entgiftung durch die Anmeldung zu einem anerkannten Abstinenzkontrollprogramm ab.
Postakute Entzugssymptome (PAES) und Craving-Management
Die psychische Dauerbaustelle: Postakute Entzugssymptome (PAES) Auch wenn der akute Alkoholentzug nach etwa einer Woche beendet ist, kämpfen viele Betroffene monatelang mit sogenannten Postakuten Entzugssymptomen (PAES). Diese äußern sich oft in starker Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen und persistentem Craving (Suchtverlangen).
Hier setzt die Entwöhnungstherapie an, um neue Bewältigungsstrategien zu erlernen. Medikamente wie Naltrexon oder Acamprosat können dabei helfen, das Verlangen biologisch zu dämpfen und das Risiko eines Rückfalls nachhaltig zu senken.
Kostenübernahme und Wartezeiten
Wer bezahlt meinen Alkoholentzug und wie lange muss ich warten? Die Finanzierung ist ein häufiges Hindernis beim Alkoholentzug, doch die gute Nachricht ist: Die körperliche Entgiftung wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Die sich anschließende psychische Entwöhnung (Reha) wird meist von der Rentenversicherung finanziert und muss dort beantragt werden.
Bei der Entgiftung ist eine kurzfristige Aufnahme möglich, während die Wartezeiten für einen stationären Entwöhnungsplatz zwischen vier Wochen und mehreren Monaten liegen können. Private Kliniken bieten oft einen schnelleren, „qualifizierten Entzug“ (Entgiftung + Entwöhnung kombiniert) über 28 Tage an, dessen Kosten jedoch meist privat getragen werden.
Fazit
Alkoholentzug ist kein einfacher Weg, aber ein lebensrettender Schritt. Körperliche und psychische Symptome können belastend sein, sind jedoch mit ärztlicher Hilfe gut behandelbar. Ein professionell begleiteter Entzug schützt vor lebensgefährlichen Komplikationen und ermöglicht den erfolgreichen Start in die Abstinenz. Mut, Unterstützung und die richtige Therapie sind die Schlüssel zu einem neuen, gesunden Leben.
Quellen:
- Alkoholentzug und Entzugserscheinungen – Alkoholsucht
- Alkoholvergiftung und -entzug – Spezielle Fachgebiete
- Alkoholabhängigkeit: Symptome, Verbreitung, Behandlung
FAQ:
Was ist der Unterschied zwischen Entgiftung und Entwöhnung?
Die Entgiftung ist der kurze, körperliche Prozess, bei dem der Körper von den akuten Substanzen befreit wird, während die Entwöhnung die langfristige, psychische Therapie der Suchtursachen darstellt. Nur die Kombination dieser beiden Schritte ermöglicht einen dauerhaft stabilen Alkoholentzug und eine Abstinenz im Alltag.
Wie lange dauert der körperliche Alkoholentzug?
Die akute körperliche Entgiftungsphase, in der die schlimmsten Symptome auftreten, dauert in der Regel etwa sieben bis zehn Tage. Die psychische Entwöhnung kann je nach Klinik und Therapieform zwischen vier Wochen und sechs Monaten in Anspruch nehmen.
Kann ich einen Alkoholentzug zu Hause alleine durchführen?
Ein eigenständiger Entzug zu Hause („kalter Entzug“) ist aufgrund der lebensbedrohlichen Risiken wie Krampfanfälle oder Delirium tremens absolut nicht ratsam. Suchen Sie für den Alkoholentzug immer eine qualifizierte Fachklinik auf, wo eine medizinische Überwachung gesichert ist.
Was sind die häufigsten Symptome eines Alkoholentzugs?
Typische körperliche Symptome sind starkes Schwitzen, starkes Zittern (Tremor) der Hände und Zunge sowie Übelkeit und Erbrechen. Psychische Anzeichen umfassen Angstzustände, Schlafstörungen, innere Unruhe und Konzentrationsschwierigkeiten.
Was versteht man unter dem Delirium tremens?
Das Delirium tremens ist die schwerste und lebensbedrohlichste Komplikation des Alkoholentzugs, die mit Halluzinationen, Fieber, starkem Herzrasen und Verwirrtheit einhergeht. Es ist ein medizinischer Notfall, der eine sofortige intensivmedizinische Behandlung erfordert.
Wann beginnen die Entzugserscheinungen nach dem letzten Konsum?
Die ersten Entzugserscheinungen setzen in der Regel bereits sechs bis 24 Stunden nach dem letzten alkoholischen Getränk ein, da der Alkoholspiegel im Blut sinkt. Die maximale Intensität der körperlichen Symptome wird meist innerhalb der ersten 48 Stunden erreicht.
Welche Medikamente werden zur Linderung der Symptome eingesetzt?
Beim warmen Alkoholentzug werden in erster Linie Benzodiazepine wie Diazepam verabreicht, um das zentrale Nervensystem zu beruhigen und Krampfanfällen vorzubeugen. Zusätzlich werden oft Neuroleptika und Vitamine gegeben, um Mangelerscheinungen und psychischen Symptomen entgegenzuwirken.
Wie geht es nach der körperlichen Entgiftung weiter?
Nach der körperlichen Entgiftung folgt die psychische Entwöhnungsphase (Rehabilitation), in der die Patienten die Gründe für ihre Sucht aufarbeiten und neue Verhaltensmuster erlernen. Eine ambulante oder stationäre Entwöhnung ist unerlässlich, um die Gefahr eines Rückfalls nach dem Alkoholentzug zu minimieren.
Wo finde ich die richtigen Ansprechpartner für einen Alkoholentzug?
Erste und wichtige Anlaufstellen sind der Hausarzt, regionale Suchtberatungsstellen oder psychiatrische Kliniken. Diese können eine professionelle Ersteinschätzung vornehmen und bei der Vermittlung in eine qualifizierte Entzugsbehandlung helfen.
Ist die Rückfallquote nach einem Alkoholentzug sehr hoch?
Die Rückfallquote nach dem körperlichen Alkoholentzug ist ohne eine anschließende Entwöhnungstherapie sehr hoch, da die psychische Abhängigkeit weiterhin besteht. Eine konsequente Nachsorge und die Anbindung an Selbsthilfegruppen sind entscheidend für eine dauerhafte Abstinenz und den langfristigen Erfolg.
Georg Jelinek ist ein ausgewiesener Spezialist in der Suchtbekämpfung mit Schwerpunkt auf Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Seine Expertise umfasst die medizinische und forensische Laboranalyse, evidenzbasierte Diagnostik sowie moderne Therapieansätze. Mit einem interdisziplinären Ansatz verbindet er wissenschaftliche Präzision mit praxisnaher Behandlung, um nachhaltige Wege aus der Abhängigkeit zu ermöglichen.

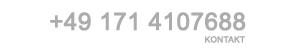


⇓ Weiterscrollen zum nächsten Beitrag ⇓